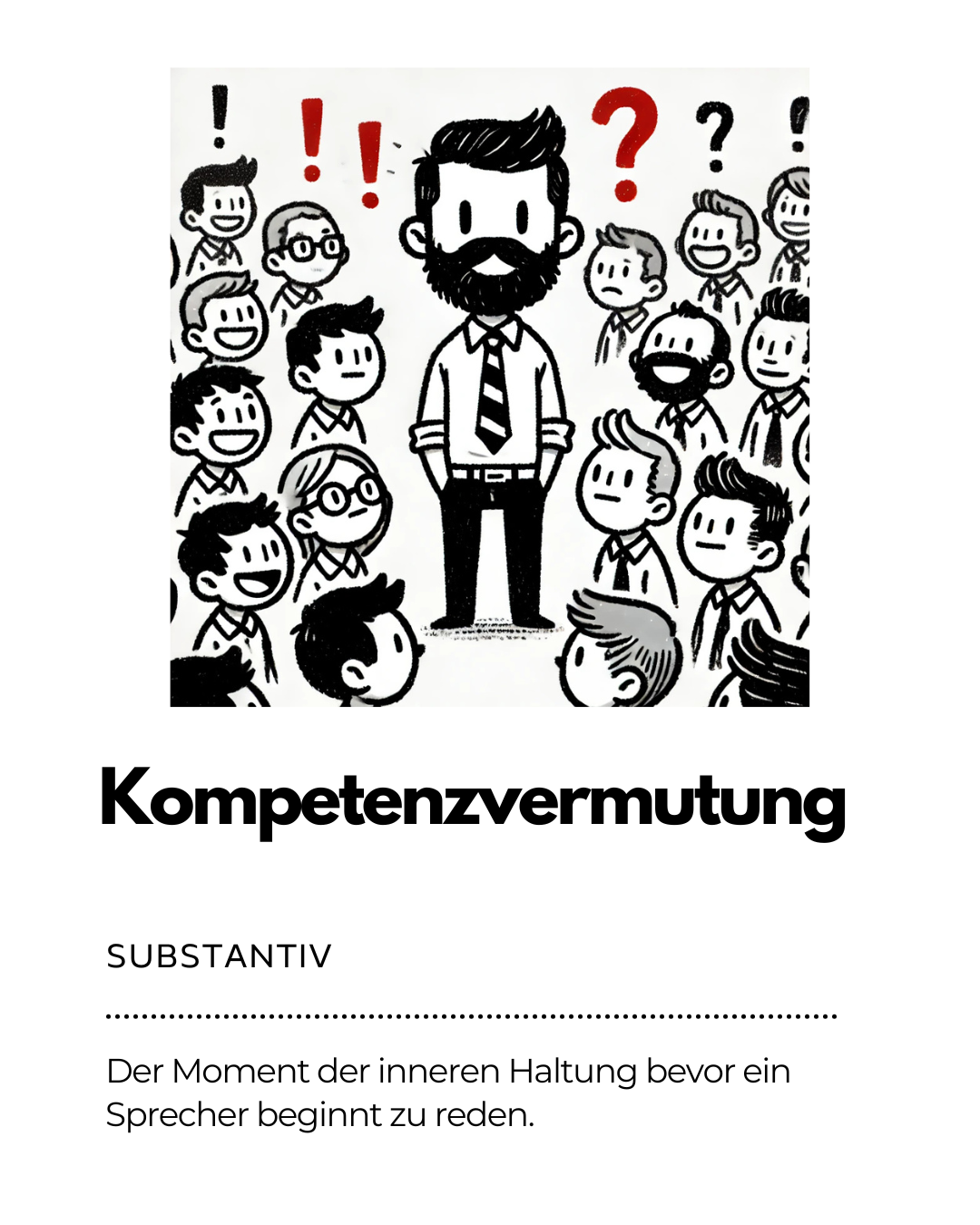„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ – Hermann Hesse, Stufen
Es gibt einen besonderen Moment, bevor jemand das Wort ergreift. Ein Moment, in dem die Zuhörer noch nichts über die tatsächlichen Fähigkeiten des Sprechers wissen – und doch bereits eine Annahme darüber getroffen haben, dass dieser Mensch etwas Wertvolles zu sagen hat. Diese Annahme, dieses unausgesprochene Vertrauen in die Fähigkeiten des Redners, ist die Essenz dessen, was man als Kompetenzvermutung bezeichnen kann. Die Kompetenzvermutung ist die stille, oft unbewusste Entscheidung der Zuhörer, dass jemand aufgrund von Reputation, Titel oder Empfehlung etwas Wertvolles beitragen wird – noch bevor die ersten Worte gefallen sind. Doch dieser Vorschuss an Vertrauen ist sowohl eine Chance als auch eine Last.
Die Kompetenzvermutung wurzelt tief in sozialen Mechanismen und psychologischen Prozessen. Menschen neigen dazu, Erwartungen aufzubauen, wenn ihnen jemand als Experte oder als besonders kompetent vorgestellt wird. Ein Redner, der als „führender Experte auf seinem Gebiet“ angekündigt wird, betritt die Bühne nicht als unbeschriebenes Blatt. Die Zuhörer haben bereits eine innere Haltung eingenommen: Sie sind bereit, sich von Wissen und Eloquenz beeindrucken zu lassen – oder im schlimmsten Fall, von ihrer Enttäuschung bestätigt zu werden.
Ein fiktives Beispiel verdeutlicht diese Dynamik: Stellen wir uns eine Wissenschaftskonferenz vor. Dr. Julia Meier, eine renommierte Klimaforscherin, wird als Hauptrednerin vorgestellt. Der Moderator preist ihre zahlreichen Publikationen, ihre Beraterrolle bei internationalen Umweltorganisationen und ihren wissenschaftlichen Durchbruch im Bereich der Klimamodellierung. Noch bevor sie das Mikrofon in die Hand nimmt, herrscht im Saal eine Atmosphäre gespannter Erwartung. Die Zuhörer gehen davon aus, dass jemand mit diesen Referenzen eine herausragende Präsentation liefern wird. Doch in dem Moment, in dem Dr. Meier zu sprechen beginnt, wird die Kompetenzvermutung auf die Probe gestellt. Spricht sie klar und überzeugend? Ist ihr Vortrag gut strukturiert? Schafft sie es, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen? Schafft sie es überhaupt mit den Zuhörerinnen und Zuhörern in Resonanz zu kommen und geht auf das anwesende Publikum und deren Horizont ein? Oder bleibt sie hinter den Erwartungen zurück und leistet am Ende dem Thema und dem Ziel einen Bärendienst?
Der Anfang, den Hesse als „Zauber“ beschreibt, ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Bewährungsprobe. Die Kompetenzvermutung schafft eine Bühne, doch der eigentliche Erfolg hängt davon ab, ob die vermutete Kompetenz durch tatsächliche Leistung bestätigt wird. Ein Redner, der mit einer ruhigen Stimme, klaren Gedanken und einer fesselnden Struktur seine Rede beginnt und sie an das zuhörende Publikum anpasst, wird die Kompetenzvermutung in tatsächliche Kompetenz umwandeln. Ein anderer hingegen, der unsicher wirkt oder inhaltlich schwach bleibt, wird die Vorschusslorbeeren schnell verspielen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Kandidatur für ein kommunalpolitisches Amt. Wenn ein Bewerber für den Gemeinderat auf einer Wahlveranstaltung spricht, bringt er automatisch eine gewisse Kompetenzvermutung mit – sei es durch seine berufliche oder bereits vorhandene kommunalpolitische Erfahrung, seine Bekanntheit im Ort oder seine Unterstützung durch eine politische Gruppe. Die Zuhörer erwarten von ihm, dass er die lokalen Themen versteht und glaubwürdige Lösungen anbietet. Doch ob diese Kompetenzvermutung trägt, entscheidet sich daran, wie klar, überzeugend und verbindlich er seine Positionen darlegt. Wenn der Kandidat überzeugend auftritt, wird die Kompetenzvermutung in tatsächliches Vertrauen umgewandelt – bleibt er jedoch in Allgemeinplätzen stecken oder zeigt Unsicherheiten, verpufft der Vorschuss an Vertrauen schnell. Die wahre Kunst besteht darin, die Bühne nicht nur durch äußere Vorschusslorbeeren zu gewinnen, sondern durch innere Stärke und echte Kompetenz zu behaupten. Der Zauber des Anfangs, von dem Hesse spricht, bleibt also nur dann erhalten, wenn der Anfang nicht nur ein Versprechen bleibt – sondern zu einer erfüllten Erwartung wird.